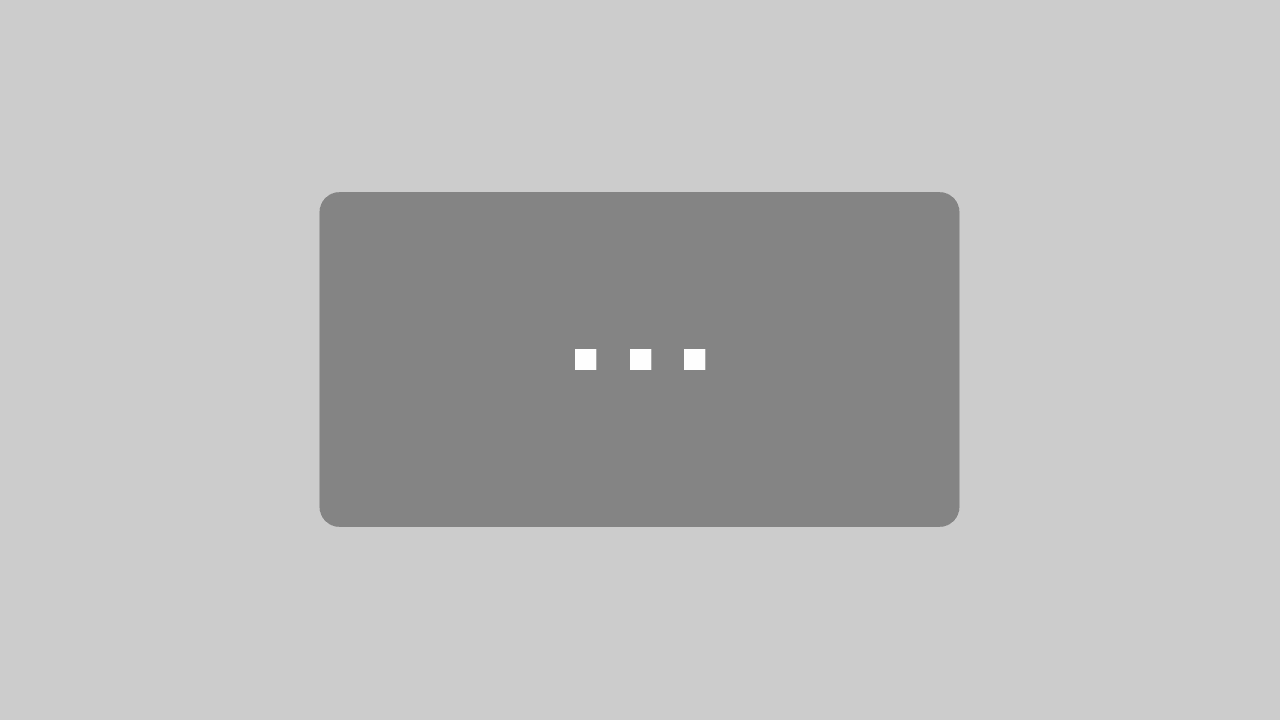Der Text gilt als erste Spielekritik Deutschlands. Er erschien am 4. Dezember 1964 in der Zeit, heißt „Dem homo ludens eine Gasse“ und ist von Eugen Oker. Mit seinen Artikeln machte Oker Spielerezensionen populär. Wir haben fünf Texte des Altmeisters dokumentiert – mit Malefiz, Monopoly und Twixt.
Dossier Spielejournalismus
Dieser Beitrag gehört zum Dossier Spielejournalismus. In dem Dossier dokumentieren wir ausgewählte Ereignisse, Beiträge und Diskussion aus der Geschichte des Spielejournalismus.
Eugen Oker
Friedrich „Fritz“ Gebhard hatte viele Pseudonyme. Eins davon war Eugen Oker. Unter diesem Namen veröffentlichte er in der Serie „Für Spieler“ von 1964 bis 1971 Spielekritiken in der Zeit. Von 1972 bis 1975 war er Spielekritiker für die Frankfurter Rundschau. 1994 erhielt er für die „Begründung der deutschen Spielekritik“ beim Deutschen Spiele Preis eine Sonderauszeichnung. Oker war nicht nur Spielekritiker, sondern auch Spiele- und Buchautor, Zeichner, Sammler und Kleinverleger. „Okers unterschiedliche Arbeitsbereiche haben eines gemeinsam: die Lust am Spielerischen, Hintersinnigen und am Augenzwinkernden, aber auch der Blick fürs Detail“, heißt es auf seiner Homepage. Oker starb am 14. März 2006 in München. Sein Nachlass bewahrt das Literaturarchiv Sulzbach-Rosenberg auf.
Aus der Zeit 49/1964, 4. Dezember 1964
Dem homo ludens eine Gasse
In unserem Lande von Lächerlichkeit bedroht
Kommt die „Spielwelle“?
Von Eugen Oker
Wenn die Nebel fallen, wenden sich die Gedanken dem deutschesten aller Feste zu, das aber heute mit der fatalen Frage verbunden ist: Was schenke ich wohl wem zu Weihnachten? Gelegenheit, nicht Anlaß zu den nachstehenden Betrachtungen, denn hier soll nicht vom Schenken, sondern vom Spielen die Rede sein.
Der spielende Mensch braucht Hilfe: Er ist in unserem Lande von Lächerlichkeit bedroht — im Gegensatz zu England, beispielsweise — denn bei uns ist mangelnder Ernst etwas Verdächtiges. Spielratten gelten als eine Art von Hanswursten, die ihre Zeit rnit zwecklosem Tun vergeuden. Zweckloses Tun ist es aber doch, was uns fehlt!
Seit einiger Zeit ist in Spielwarengeschäften ein Phänomen zu beobachten: Schüchterne Erwachsene „schmökern“ in den flachen Schachteln der Abteilung „Gesellschaftsspiele“. Die Fragen der Verkäuferinnen („Für welches Alter soll’s denn sein?“), und ihr Rat (Das ist aber ein sehr kompliziertes, ab fünfzehn) sind gut gemeint. Sie wollen diese Spiele aber für sich selber erwerben. Und sie möchten sie vorher gern anschauen, den Spielplan studieren und besonders natürlich die Anleitung, denn es sind Fachleute: Spielratten. Sie wünschten Stühle um einen Tisch in einer Ecke, Ruhe zum Ausprobieren, Vorgenießen, sorgfältiges Auswählen, nicht bedrängt von ungeduldigen Verkäuferinnen und aufgekratzten Kindern. Das wird der bisher einzig einschlägige Fachhandel, eben die Spielwarenbranche, dem neuen Kunden bieten müssen, will sie ihn, der semer Art nach die Atmosphäre eines Buchladens vorzöge, gäbe es dort Spiele, behalten.
Woher kommt er plötzlich, der homo ludens, in so beachtlicher Zahl, daß ihm die bisher nur auf Kinder eingestellten Läden heute ein Sortiment bieten, das man vor wenigen Jahren vergeblich gesucht hätte? Der gestiegene Lebensstandard mit seinen Errungenschaften — die komfortable Wohnung, die längere Freizeit, der Fernsehapparat, das Auto — haben offenbar eine gesellschaftliche Umorientierung bewirkt, die als Basis in stärkerem Maße die Familie in den Mittelpunkt gerückt hat: Das eigene Heim ist der größte Konkurrent des Gasthauses, früheres Zentrum der Familienväter. Diese Entwicklung steht jedoch noch an ihrem Anfang. Nicht von ungefähr bieten vorerst nur die Geschäfte in den Großstädten und an hochfrequentierten Ferienorten die große Auswahl. Es brauchte im Urlaub nur einen Tag zu regnen, und schon begann der Run auf die Spielwarenläden.
Auch das Fernsehen hat einen gewichtigen Anteil: Quizsendungen, „Gewußt wo?“, „Paßwort“ und andere haben den Spielratz angesprochen. Der Handel sollte die Konsequenz aus dieser sich abzeichnenden Entwicklung ziehen und dem neuen Kunden die Befangenheit nehmen. Die Verleger sollten ihre Produktion auf ihn, den Anspruchsvollen, einrichten durch attraktivere graphische Gestaltung der Verpackung, wie das der Buchhandel schon längst und seit etlicher Zeit auch die Schallplattenindustrie macht. Menschen, die .spielen, scheinen uns friedliche Menschen von der rechten Sorte zu sein: Sie unterwerfen sich freiwillig komischen Regeln, huldigen dem Humor und dem Fair play. Zu ihrer Ermunterung wollen wir beitragen. Warum soll es nur Besprechungen von Büchern, Filmen, Theaterstücken geben? Warum nicht auch kritische Beschäftigung mit… Spielen?
Ärgern ist gesund
Halma, Mühle, Fang den Hut und alles, was in den verschiedenen Spielemagazinen enthalten ist, ist Hausmannskost. Wer gern spielt, schätzt das Verfeinerte. Es gibt Spiele, die einen gemeinsamen Stamm haben, deren Grundidee jedoch durch Raffinements zu einem ganz neuen Spiel sublimiert wurden. Dazu gehört auch Das Malefizspiel; Otto Maier Verlag, Ravensburg; Nr. 11 411 4,80 DM, Nr. 11412 7,80 DM. Es geht auf das unverwüstliche „Mensch ärgere dich nicht“ zurück, ist aber noch um etliche Grade vermaledeiter und trägt somit seinen Namen zu Recht. Wie bei allen wirklich faszinierenden Würfelspielen ist die Idee auch hier recht einfach: Man hat auf einer verästelten Spielroute von fünf „Männchen“ eines ins Ziel zu bringen. Dabei darf vor- und zurückgezogen und „geschmissen“ werden. Doch ist der Weg steinig im wahrsten Sinne des Wortes. Über die Strecke verteilt, befindet sich eine Anzahl von Barrikaden; kleine weiße Holzzylinder, über die man nicht hinwegkann. Man muß sie erst entfernen. Dies geschieht, indem man ihren Platz durch direkten Wurf mit einem seiner Figuren erreicht. Das erlaubt dann dem Spieler, das Hindernis irgendwohin, meist einem Mitspieler vor die Nase, zu setzen. Das ist alles.
Mehr wäre aber auch entschieden zuviel: Beim „Malefiz“ kann man lernen, seinen besten Freund zu verfluchen. Und man sollte die Spielregeln um eine emotioneile Variante erweitern. Etwa durch die Erlaubnis jeglicher indirekter Einflußnahme wie warnen, überreden, drohen, bitten, durch echte und falsche Ratschläge, Bildung von Bündnissen, Veranstaltung gemeinsamer Hetzjagden. So wird „Malefiz“ zu einem Spiel, an dem Freud seine Freude gehabt hätte: zur Katharsis. Ein Gesundbad für strapazierfähige Freundschaften und solche, die es werden wollen.
„Malefiz“ gibt es in zwei Ausgaben. Die ältere ist mir lieber. Der Spielplan ist zwar vergleichsweise nüchtern, aber die Route ist weiträumiger, erlaubt mehr taktische Kombinationen, begünstigt Ausreißer, ermuntert Koalitionen auf etwas längere Zeit als nur ein paar Würfe. Der neue ist graphisch sehr reizvoll gestaltet und hat einen Bruder auf der Rückseite. Für sechs Personen. Der ähnelt aber sehr dem „Mensch-ärgere-dich-nicht„- Sechser: Das Spiel dauert sehr lange. Man spielt „Malefiz“ zu zweit, zu dritt und zu viert mit gleichem Vergnügen. Aber zu viert ist es am schönsten.
Aus der Zeit 07/1965, 12. Februar 1965
Möglichst viele Pärchen
Von Eugen Oker
Man beschließt – und man tut dies beinahe täglich –, ein bestimmtes Programm im Fernsehen anzusehen. An – zusehen. Man nimmt sich vor, bei Beginn der Sendung anwesend zu sein, um zu prüfen, ob man sie anschauen werde. Schließlich weiß man nach spätestens fünf Minuten, ob sie halten wird, was sie verspricht. Tut sie’s nicht, schaltet man einfach ab. Jedoch – was tut man dann? Dann fällt nämlich die unerfüllte Erwartung so zentnerschwer auf die müden Feierabendschultern, daß man … eben nicht abschaltet.
Auf diese Weise kommt viel Schmarren unter die Leute. Oft hat man das Gefühl, daß die Sender darauf geradezu spekulieren, mehrmals hintereinander sogar. Denn der Mensch sagt sich: Na, diese Sendung ist zwar nicht so besonders; aber in einer Stunde kommt die nächste, sicher ist die besser.
Dagegen sollte man etwas unternehmen. Ich bin in solchen Fällen – wie sollte es anders sein – fürs Spielen. Es gibt genug Spiele, die kurzweiliger sind als so manches aufwendige Programm. Aber für diesen speziellen Fall sind zwei unabdingbare Forderungen zu stellen:
Sie dürfen nicht lang dauern, und man muß sie gern mehrmals hintereinander spielen mögen: Anti-Fernseh-Spiele also. Das sind zum Beispiel „Memory„, „Ecco“ und „Bicardo„. Es handelt sich hier um dreimal das gleiche. Bekannt wurde dies, hier gegen das Fernsehen angepriesene Spiel ausgerechnet durch das Fernsehen. Vor wenigen Jahren hieß eine Unterhaltungssendung „Gewußt wo?“ Sie setzte sich nicht durch. Man hatte zwei Felder von vielen in einem quadratischen Gefach zu bezeichnen, worauf sie sich auf geheimnisvolle Weise drehten und für kurze Zeit einfache Darstellungen zeigten, die dann wieder verschwanden. Jedes dieser Bildchen gab es zweimal. Wer solch ein Pärchen aufstöberte, bekam einen kleinen Preis. Genau so geht „Memory„; Otto Maier Verlag, Ravensburg. Schachtel mit 36 oder 54 Paar Kärtchen; Nr. 15562: 3,50 Mark, Nr. 15559: 6,80 Mark; für zwei Personen und mehr.
„Memory“ heißt auf deutsch nicht nur Gedächtnis, sondern auch Erinnerungsvermögen, und dies trifft das Spiel genau: das Vermögen, sich zu erinnern, an welcher Stelle von hundert man welches Bild schon gesehen hat. Tippt man recht, sagt man vielleicht erfreut: „Sieh da!“
Das heißt auf italienisch „Ecco„; Verlag Abel-Klinger, Fürth; 5,50 Mark. Man spielt es so: Die gut gemischten Kärtchen werden der Reihe nach verdeckt so auf den Tisch gelegt, daß ein Geviert entsteht. Wer beginnt, dreht zwei beliebige Bilder für jeden sichtbar um. Sind’s zwei verschiedene, was ja anfangs die Regel ist, so stellt man darauf die Grundstellung wieder her. Dies setzt sich von Teilnehmer zu Teilnehmer fort, bis schließlich jemand mit seiner ersten Karte eine Darstellung lüpft, die schon da war. Die sucht er nun als zweite zu finden. Greift er daneben, geht das Spiel weiter. Wer’s errät, behält das Paar und darf gleich nochmal. So mancher erntet dabei vom Erinnerungsvermögen seines Vorgängers. Die Verlage foppen natürlich mit ähnlicher Farbgebung bei verwandten Dingen: Haus und Kirche, Sonne und Mond, Elefant und Seehund. Sieger ist schließlich der Besitzer der meisten Paare.
A propos Paare: „Bicardo„, Braunkohlenbrikett – Beratungsstelle Köln, Postfach 1425; gegen Schutzgebühr, finde ich besonders hübsch. Die Schachtel kann man auch im modernsten Wohnzimmer für jedermann sichtbar liegen lassen. Daß den Werbeleuten von der Braunkohle eine Menge Hübsches eingefallen ist, weiß jeder, der Zeitungen liest, ins Kino geht oder in den Fernsehapparat schaut. Also jeder. In der Tat: Zwar hat man es mit nichts als nur Briketts zu tun, mit prosaischen Aschenschubern, Ofenrosten, Kohlensäcken, Gütezeichen, Fünfmarkstücken und Schaufelradbaggern, doch der Umgang mit den restlichen Bildchen, den hübschen Mädchen vor Allesbrenneröfen, den lustigen und graphisch gelungenen Männchen, Schornsteinen, Mietzekatzen und Slogans ist ebenso sympathisch, wie sie das Spiel auch vertrackt machen. Und warum sollte man die Solidarität mit den Kumpels an der Ruhr und anderen Zechen nicht wenigstens dadurch zum Ausdruck bringen, daß man, während die vollautomatische Ölheizung behagliche Wärme verbreitet, „Bicardo“ spielt? Weil’s vernünftig ist.
Aus der Zeit 08/1965, 19. Februar 1965
Der Reichste gewinnt
Von Eugen Oker
Als der Makler Gierling in Neureichengrundlach mit beschränktem Kapital ins Immobiliengeschäft einstieg, sah er sich mehreren Konkurrenten gegenüber. Er erwarb eine Anzahl von Grundstücken, die er aber bald mit Hypotheken belasten mußte, um monetär flüssig bleiben zu können. Seine finanzielle Situation verschlechterte sich noch, als ihn eine Gefängnisstrafe in seiner Bewegungsfreiheit hinderte. Nahe dem wirtschaftlichen Ruin gelangen ihm mit seinen letzten Reserven Aufkäufe. Ein besonders wertvolles Grundstück ersteigerte er äußerst preiswert – und von da an datiert sein kometenhafter Aufstieg. Kaum erholt, investierte er knappes Geld in Neubauten; sie warfen astronomische Mieten ab. Ein neuer Aufenthalt hinter Gittern konnte ihm nun nichts mehr anhaben, auch wenn sein Verhalten nach der Entlassung allgemein als unseriös empfunden wurde. Er beteiligte sich beispielsweise an einer Schönheitskonkurrenz, bei der den zweiten Platz errang, er hatte auch Strafen wegen Trunkenheit und zu schnellen Fahrens zu berappen. Unmittelbar nach einem teuren Aufenthalt im Krankenhaus gelang es ihm, seinen Besitz mit Methoden zu arrondieren, die an Erpessung grenzten. Als die Kommunalverwaltung ihn zu beträchtlichen Straßensicherungsabgaben heranzog, geriet Gierlings finanzieller Balanceakt doch ein bißchen ins Wanken: Die Hypotheken begannen wieder zu drücken. Aber schließlich setzte er sich, dank seiner erbarmungslosen Härte einem seiner Kollegen gegenüber, den er skrupellos in die totale Pleite trieb, durch. Gierling gilt heute als angesehener Bürger der Stadt Neureichengrundlach.
Dies ist nicht der Recherchentext einer Auskunftei, sondern das Spielprotokoll eines Teilnehmers an
„Monopoly„; Verlag Franz Schmidt, München; Karton mit Spielplan, zwei Würfeln, sechs Halmakegeln, 32 grünen und zwölf roten Häuschen aus Holz, zwei Kartensätzen von je sechzehn Karten, 28 Besitzrechtskarten und 232 000 Mark Spielgeld in verschieden hohen Scheinen. Für zwei bis sechs Personen; Nr. 102/2 DM 10,50; Nr. 102/3 (Luxusausführung mit zweifarbigen Kunststoffhäuschen und einem Geldeinsatz mit acht Fächern) 21 Mark.
Das Spiel ist 1935 in den USA erfunden worden; in Deutschland trat es nach der Währungsreform seinen Siegeszug an. Schon in einer Zeit also, da vom Wohlstand bestenfalls geträumt werden konnte, regte es die Phantasie mächtig an und feierte, als der Traum zur Realität wurde, wahre Triumphe. „Monopoly„, ein rechtes Wirtschaftswunderkind, ist wohl das derzeit am meisten gekaufte Spiel.
Ich mag das Spiel nicht. Wenn ich beobachte, wie die Augen der Teilnehmer glänzen, die Köpfe zu glühen beginnen, wie sie feilschen, wuchern, Geld stapeln, dann wird mir unbehaglich zumute. Überhaupt das Geld, dieses unaufhörliche Zahlen und Kassieren: Für einen Hauptkassierer wäre dies die Schwerarbeit an einem Monatsersten. Und dann die Selbstverständlichkeit, mit der man die Begriffe Immobilien und Gefängnis in Beziehung setzt! Theodor Müller-Ahlfeld nennt in seinem empfehlenswerten Büchlein „Brettspiele“ (Ullstein Nr. 417) das Spiel „Der kleine Grundstücksmakler“.
Nach dieser privaten Nörgelei muß aber nun vom Spiel gesprochen werden – und da muß ich es preisen. Das Spielsystem ist neu und äußerst raffiniert dazu: die Wechselfälle von Würfel und Karte vereint, der eignen Klugheit Maß, der Leidenschaft Verhängnis, des Besitzes Macht und Fluch – hier wird’s Ereignis.
Von zwei Würfeln angetrieben, rennt man stets entlang der gleichen Bahn um den Spielfeldrand. Das Feld hat vierzig Felder. Mit einem Grundkapital erwirbt man im Verlauf des Spieles Grundstücke und baut darauf Häuser und Hotels. Ein „Gehalt“ nach jeder Platzumrandung stockt die Barmittel auf. Der Vorgang ist kompliziert, doch sehr klug ersonnen. Deshalb ist auch die Spielanweisung acht Seiten stark.
Eine ganze Seite beschreibt allein die Prozedur, wann man ins Gefängnis muß und wie man wieder herauskommt.
Auf jenen Feldern, die andere erworben haben, muß Miete gezahlt werden. Die ist um so höher, je mehr Grundstücke gleicher Kategorie der Eigner jenes Feldes besitzt und je mehr Häuser darauf stehen. Allmählich wird dieser „Gang durch die Stadt“ zum Alptraum: Überall sind Sperren, hochdotierte Straßen, die, tappt man hnein, schrecklich hohe Zahlungen im Gefolge haben. Da muß man dann die eigenen Häuser verkaufen (zum halben Preis), Hypotheken aufnehmen, um den harten Gläubiger zu befriedigen, oder einen unvorteilhaften Handel eingehen. In diesem Stadium ist man froh, auf einem der sechs „Ereignisfelder“ zu landen. Da teilt einem dann eine Karte mit, ob man Versicherungen, Schulgeld oder Zinsen zu zahlen hat, ob man Steuern zurückerhält oder bei einem Wettbewerb gewinnt, ob man vorrücken oder ins Gefängnis „darf “ – denn bei soviel Gefahr auf dem Weg ist die Gelegenheit, dreimal aussetzen zu müssen, eine ersehnte Verschnaufpause.
Sieger – also Monopolist – wäre jener Spieler, dem am Schluß die ganze Stadt gehört. Da aber die Wechselfälle des Spieles nur selten diesen Ausgang zulassen, rät die Gebrauchsanweisung zur zeitlichen Begrenzung. Freilich: drei Stunden muß man dafür schon ansetzen. Am besten stellt man einen Wecker. Das Spiel ist jedoch meist so spannend, daß die Frist auf „allgemeinen Wunsch“ von halber zu halber Stunde verlängert werden muß. Schließlich gewinnt der Reichste.
„Monopoly“ hat eine Menge von sympathischen Kindern und Enkeln. Von ihnen wird noch die Rede sein müssen.
Ich spiele „Monopoly“ ungern und selten. Aber wenn, dann packt es mich.
Leute, die glauben, keinerlei atavistische Neigungen zu haben, sollten dies nicht an die große Glocke hängen: Sie könnten zu einer Partie „Monopoly“ eingeladen werden.
Aus der 28/1965, 9. Juli 1965
Adieu
Von Eugen Oker
Nicht im Traum hätte ich, als diese Serie im Dezember vorigen Jahres begann, geglaubt, daß es in unserem Land so viele gute Spiele gäbe. Das war die eine Überraschung. Die andere war eigentlich gar keine, denn ich war von vornherein überzeugt, daß jene Außenseiter, die sich fast ihres Steckenpferdes schämten, nämlich die Spielratten, zu denen ich mich zählte, auch hierzulande zahlreicher sind, als man gemeinhin annimmt.
Die Spielwiese ist abgegrast. Nicht ganz. Da stehen noch einige Büschel. Wenn sie nicht mehr einzeln besprochen werden, so hat das Gründe. Einer davon ist, daß die Gattung, der sie zugehören, schon breit genug erörtert worden ist. So wären noch ausstehende Titel aus der Familie „Monopoly„, wie „Karriere“ (Franz Schmidt, München; 8,40 Mark), „Wild Life“ (19,80 Mark), eine aufregende Großwildjagd, und „Moby Dick“ (14,80 Mark), ein Walfangspiel auf einer Drehscheibe (die Wale „tauchen“ plötzlich weg) zu nennen.
An Kriminalspielen gibt es noch: „Lügendetektor„, eine sehr vergnügliche Verbrecherjagd mittels eines raffinierten Apparates, der über Hollerith-Karten positive und negative Indizien liefert (Franz Schmidt, München; 17,85 Mark) und das makabre Gespensterspiel „Warum„? von Alfred Hitchcock, bei dem es darum geht, jenen Geist von mehreren spurlos verschwundenen Personen zu finden, der im Schloß spukt (Maier, Ravensburg; 9,80 Mark) und andere…
Ein spezielles Wort noch den Puzzle-Freunden: aus ihrem Kreis kamen die meisten Briefe. Der Puzzle-Markt hat sich auch sehr erweitert: Maier, Ravensburg, brachte eine sehr hübsche Serie heraus: „Entdeckungen und Erfindungen„, Bilder nach alten Originalen, so die Montgolfiere, die erste Eisenbahn, das erste Automobil (je 350 Teile, 3,90 Mark). Außerdem noch die „World-Wide-Serie„, Farbphotos von Städten, ganz vertrackt gestanzt. Die Teile sind so ähnlich, daß man gleichfarbige leicht an den falschen Stellen einknöpfelt (520 Teile, 4,50 Mark). Erfreulicherweise trägt auch das Ausland seinen Teil zu einer größeren Auswahl bei. Da sind die hübschen „Jumbo„-Puzzles (Hausemann & Hötte, Amsterdam), und für Fanatiker mit viel Zeit und einem eigenen Zimmer kommen von Jouets Vera, Paris, die Kunstserien „Apollo“ und „Art Moderne“ (bis zu 2500 Teile) sowie die Hackbild-Monstren von „Rex“ und „Royal“ (bis zu 4000 Teile). Man sieht, sie existieren wirklich und wahrhaftig, jene, die man in Orson Welles’ Film „Citizen Cane“ bestaunen konnte.
Damit wäre tabula rasa gemacht. Die Spalte „Für Spieler“ verschwindet damit nicht etwa völlig in der Versenkung. Die Serie hat nur das bisherige Brachland in einen überschaubaren Garten verwandelt. Und wie Buch-, Film- oder Theaterkritik wird sich der jüngste Sproß dieses Genres nunmehr gleichfalls nur mit den Neuerscheinungen zu befassen haben. Da sie nach Lage der Dinge seltener sind, werden Paul Floras Halmakegel nur sporadisch wieder auftauchen
Aus der Zeit 48/1967, 1. Dezember 1967
Beinahe primitiv – aber erstklassig
Von Eugen Oker
Wenn jemand eine Sandgrube besäße – wie würde er daraus wohl am besten Kapital schlagen? Mit Bausand? Gut. Oder Putzsand? Besser. Aber man muß schon Amerikaner sein, um das maximale Verhältnis zwischen möglichst wenig Ware (Sand) und möglichst viel Geld herauszufinden: Der Mann verkaufte seinen Sand dünn auf Papier, als Schleif- oder Sandpapier. Heute ist aus der Sandgrube ein mächtiges Wirtschaftsimperium geworden, das 35 000 verschiedene Artikel feilhält, darunter Lacke, Magnetbänder, Klebstoffe, Kopiergeräte, ganze Lehrprogramme. Das ist die 3-M-Story, die Geschichte der Minnesota Mining & Manufactoring Company. Was das mit Spielen zu tun hat? Nun, sie macht welche.
Leider kenne ich die Story der 3-M-Spiele nicht. Vielleicht war sie so: Die Sandgrube enthielt auch gröberes Material, Kiesel etwa, zwar hübsch, aber nicht recht verkäuflich. Da kam man drauf, daß die Indianer mit solchen Steinchen spielen, auf einem Brett mit Mulden darin: Es wurde das erste 3-M-Spielchen, nämlich „Ohwah-ree“.
Aber das ist nicht das Entscheidende. Als viel wichtiger empfand ich, daß 3-M die Spiele um neunzig Grad dreht: Sie stellt sie auf. Man bekommt nicht mehr einen lästigen Karton, sondern einen Buchschuber, und damit ist das Spiel sozusagen salonfähig geworden. Denn es kommt nun von selber dorthin, wo es hingehört: nicht in irgendeine Ecke, eine Schublade, einen Schrank, sondern ins Bücherregal, wo es jederzeit greifbar ist und noch dazu gut aussieht.
Wenn die 3-M-Leute etwas machen, dann machen sie es offensichtlich perfekt. Aufmachung, Utensilien, ja sogar die Spielregeln, dieses Stiefkindes der deutschen Spielemacher sind ohne Fehl. 3-M weiß auch, daß – neben dem Auge – auch die Hand mitspielt. Darum sind die „Jumpin“-Figuren aus schwerem Metall, deshalb die Kieselsteinchen und die Glasmurmeln beim „Ohwah-ree“, darum Kunststoff bei „Twixt“ und „Quinto“. Und: nichts fällt durcheinander, der Raum ist genutzt, Ordnung leicht gemacht.
Noch etwas: wer einmal ein 3-M-Spiel auf dem Bücherbord stehen hat, will alle haben. Der Sammelbetrieb wird mächtig angeregt.
Die Spiele sind durchweg vorzüglich bis erstklassig, dabei nahezu primitiv – sie spielen sich von selber. Bei „Oh-wab-ree“ sind Steinchen rundum in Gruben zu verteilen. Wer das letzte in eine reife Mulde bringt, darf sie leeren; reif ist eine Mulde, wenn sie ein oder zwei Kiesel enthält.
„Jumpin“ ist eine raffinierte Variation von Halma, doch springt man hier auch über ganze Kolonnen, jedoch nicht übers Eck. Beim „Twixt“ steckt man wechselweise Türmchen, die man mit schraubenschlüsselähnlichen Gliedern verbinden kann. Wer seine beiden Grundlinien mit einer Brücke über den ganzen Plan verbinden kann, ist Sieger.
Im „Quinto“ ist das Prinzip des Kreuzwortspiels auf Zahlen reduziert. Es gilt, Zahlen bis zu fünf Stellen aus- oder anzulegen. Ihre Quersumme muß immer durch fünf teilbar sein.
In den USA gibt es diese Spiele nicht im Spielwarenhandel, sondern in den Buch- oder Schreibwarenabteilungen der besseren Geschäfte. Heuer hat die 3-M-Company nun ihre Fingerspitzen in den deutschen Markt gesteckt, sie aber sogleich wieder zurückgezogen. Der Test verlief negativ und das ist wohl kein Wunder; denn ohne die geringste Werbung, ohne das kleinste Inserat, nur dadurch, daß man, verstreut an „Schwerpunkten“, einige Partien Spiele in Kommission verteilt, geht es nicht. Spieler sind keine Hellseher
Ich habe diese Kolumne vor drei Jahren mit dem Notruf eröffnet, man solle sich besser um den erwachsenen Spieler kümmern. Der zaghaftige 3-M-Versuch war das einzige Zählbare in der Zwischenzeit, sieht man von dem tapferen Versuch einer Einzelgängerin ab, die Spieler durch den Versandhandel zu erreichen trachtet. Ist es wirklich solch ein Risiko, dem Spieler in diesem Lande eine Quelle zu erschließen, aus der er sich laben mag, ohne den Ruf des haltlosen Glücksspielers oder den eines Kindskopfes in Kauf nehmen zu müssen? Man gebe ihm eine Stätte, die seiner würdig ist, wo er, der Spieler von der rechten Art, das sein kann, was er ist, ein Mensch von Kultur, mit Phantasie und Humor. In welch anderer Lokalität im weitesten Bereich des Handels sollte das wohl sein, wenn nicht in der Buchhandlung?